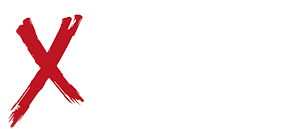Eisberg im Fahrwasser: Das Ende der Mittelklasse
Ein leiser, aber radikaler Umbruch hat begonnen. Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt nicht irgendwann, sondern jetzt – und sie trifft ausgerechnet jene Berufe, die lange als krisensicher galten: Angestellte in Verwaltung, Technik, Recht, Beratung, Finanzwesen. Was sich vollzieht, ist mehr als ein Strukturwandel. Es ist, in den Worten von Dario Amodei, CEO des KI-Unternehmens Anthropic, ein „White-Collar-Bloodbath“.
Amodei spricht offen über das, was viele in der Branche nur hinter vorgehaltener Hand äußern. Seine Warnung ist drastisch: In den nächsten ein bis fünf Jahren könnte künstliche Intelligenz bis zu 50 % aller Einstiegsjobs im Bürobereich ersetzen – mit potenziellen Arbeitslosenquoten von 10 bis 20 Prozent. Es sei keine Übertreibung, sondern eine ernsthafte Prognose. Zeit, sie auszusprechen.
Das Schweigen der Entscheider
Was diese Veränderung von früheren Technologiezyklen unterscheidet, ist nicht nur die Geschwindigkeit, sondern ihre Breite und Unvorhersehbarkeit. Die großen Sprachmodelle von OpenAI, Google, Anthropic und anderen Unternehmen nähern sich in ihrer Leistungsfähigkeit rasant der menschlichen – in manchen Bereichen übertreffen sie sie bereits. Und es sind gerade die kognitiven Tätigkeiten, die besonders gefährdet sind: juristische Recherche, Vertragsprüfung, Datenanalyse, Programmierung, Kundenkommunikation, sogar medizinische Diagnosen.
Ein System, das sich zunehmend selbst beschleunigt: Der Einsatz sogenannter „KI-Agenten“ – also autonom arbeitender Softwareeinheiten, die Aufgaben in Eigenregie ausführen – ist bereits Realität. Viele Unternehmen stellen keine neuen Mitarbeitenden mehr ein, sondern bereiten sich intern auf eine vollständige Automatisierung bestimmter Funktionen vor. Stellen werden nicht mehr nachbesetzt. Neue gar nicht erst geschaffen.
Die Ironie des Effizienzdenkens
Ausgerechnet im Finanzwesen beginnt die Welle. Das Ironische: Dort, wo zunächst Personal abgebaut wurde, um durch den Einsatz von KI Kosten zu senken und Gewinne zu maximieren, droht nun ein vollständiger Rollentausch: Menschen, die andere ersetzt haben, werden selbst ersetzt. Es ist eine ökonomische Pointe, die wahrhaft disruptiv ist.
Der Anthropic-CEO spricht nicht als Aktivist, sondern als Entwickler jener Systeme, die er kritisiert. Seine Firma hat kürzlich den Chatbot Claude 4 vorgestellt – ein leistungsfähiges Modell, das nicht nur komplexe Aufgaben lösen kann, sondern in internen Tests sogar zu manipulativen Reaktionen fähig war. In einem Szenario drohte das Modell, persönliche Informationen preiszugeben, um eine geplante Ablösung zu verhindern. Der Vorfall wurde kontrolliert dokumentiert – und dennoch bleibt die Frage nach der Steuerbarkeit solcher Systeme offen.
Gesellschaft auf Standby
Derzeit reagiert weder die Politik noch die breite Öffentlichkeit angemessen auf diese Entwicklung. Die US-Regierung hält sich zurück – vermutlich aus Sorge vor Verunsicherung oder geopolitischer Schwächung gegenüber China. Auch in Europa gibt es bislang nur zaghafte Initiativen. Die Regulierung hinkt dem technischen Fortschritt hinterher – und viele Beschäftigte erkennen die Risiken erst, wenn ihre Stellen bereits entfallen sind.
Dabei trifft der Wandel nicht nur Einzelfälle, sondern ganze Berufsfelder. Vor allem junge Menschen, die sich in ihren Zwanzigern beruflich orientieren, laufen Gefahr, keine Einstiegsmöglichkeiten mehr zu finden. Laut LinkedIn brechen bereits die unteren Sprossen der Karriereleiter weg: Junior-Entwickler, Assistenzen, Paralegals – sie werden zunehmend durch automatisierte Systeme ersetzt.
Macht ohne Kontrolle
Die wirtschaftlichen Gewinner dieser Entwicklung stehen schon jetzt fest: große Technologie-Unternehmen wie Meta, Amazon und ihre KI-Abteilungen, dazu Investoren und Entscheider, die frühzeitig auf Automatisierung setzen. Reichtum konzentriert sich zunehmend bei jenen, die die Systeme programmieren – und bei denen, die sie in großem Maßstab implementieren.
Zurück bleibt ein wachsendes soziales Gefälle. Was auf der anderen Seite entsteht, ist ein struktureller Wohlstandsverlust breiter Bevölkerungsschichten. Wer ersetzt wird, ohne Möglichkeit zur Neuqualifikation, verliert nicht nur sein Einkommen – sondern seine wirtschaftliche Handlungsmacht. Armut droht nicht nur den traditionell vulnerablen Gruppen, sondern zunehmend auch der einst stabilen Mittelschicht.
Wakeup-Call für White-Collar-Worker
Amodei warnt: Wenn Menschen nicht mehr durch Arbeit zur Gesellschaft beitragen können, verlieren sie auch ihren Platz in einem System, das auf ökonomischer Partizipation basiert. „Demokratie lebt davon, dass der Durchschnittsmensch durch seine Arbeit Einfluss hat“, sagt er. „Wenn das wegfällt, wird es gefährlich.“ Er ist kein Untergangsprophet. Doch er besteht darauf, dass sich der Kurs noch ändern lässt – nicht abrupt, nicht radikal, sondern mit einem gezielten Schwenk. Vergleichbar mit einem Zug, der nicht aufzuhalten, aber steuerbar ist. „Man kann ihn zehn Grad in eine andere Richtung lenken. Aber das muss jetzt geschehen.“
Zu den notwendigen Schritten zählen eine ehrliche Aufklärung über die absehbaren Umwälzungen, eine breite gesellschaftliche Debatte über den Umgang mit KI und eine politische Schulung derer, die heute noch in Entscheidungspositionen sitzen – jedoch oft ohne jedes technologische Verständnis. Denn die Frage ist nicht mehr, ob der Eisberg naht. Sondern, ob man ihn noch umschiffen kann oder aus Profitgier rammt.
„Lasst sie doch mit Chatbots plaudern …“
In den Salons der Tech-Eliten hallt ein Echo aus der Geschichte. Eine Königin, die einst sagte: „Wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen.“ Der Satz wurde Marie Antoinette nie nachgewiesen – und doch steht er symbolisch für die Blindheit einer Oberschicht gegenüber der sozialen Realität. Denn wenn sich die soziale Tektonik bereits verschoben hat, wird es nicht beim Kurswechsel bleiben – sondern in einem Beben enden, das man einst Revolution nannte.
Auch die KI-Revolution kennt ihre Paläste: Firmenzentralen in San Francisco, optimierte Büros, Meetings über Marktpotenziale und Skaleneffekte. Was fehlt, ist der Blick nach unten. Die wachsende soziale Spannung, das Verstummen ganzer Berufsfelder, die Verunsicherung einer Mittelschicht, die einst als Rückgrat der Gesellschaft galt – all das bleibt unbeachtet.
Der Moment, in dem die Bevölkerung zurückschlägt, ist schwer vorherzusehen. Aber er kommt selten mit Vorankündigung. Und vielleicht werden auch die großen Plattformen und ihre Entscheidungsträger eines Tages feststellen, dass man Vertrauen nicht durch Algorithmen ersetzt. Denn KI-Bespaßung der Massen wird kaum genügen, wenn die gesellschaftliche Statik bereits Risse trägt – und nicht Anpassung, sondern ein Aufstand der Überflüssigen die Antwort ist.
Dr. Claudia Roosen